Wie sieht der Spitzensport im Jahr 2040 aus – und welche Rolle spielt Technologie in seiner Entwicklung? Eine neue Delphi-Studie des Center for Sports and Management (CSM) der WHU – Otto Beisheim School of Management bietet spannende Aussichten auf diese Frage. Besonders im Fokus: die Potenziale des Para Sports als Innovationsfeld. Im Auftrag des Bundesinstituts für Sportwissenschaft wurden 62 Expert:innen aus Sportpraxis, Wissenschaft und Wirtschaft befragt. Ihr Urteil ist eindeutig – technologische Innovationen bergen große Chancen, treffen aber auf strukturelle Hürden, die dringend überwunden werden müssen.
Para Sport als Innovationslabor
Im Para Sport ist Technologie nicht bloß ein Add-on – sie ist oft elementarer Bestandteil sportlicher Leistung. Prothesen, Assistenzsysteme oder digitaler Kommunikationstools ermöglichen teilweise überhaupt erst die Teilnahme am Wettbewerb. Dr. Christoph Weber, Bundestrainer Wissenschaft beim Deutschen Behindertensportverband (DBS), spricht von einem „prädestinierte[n] Innovationsraum, insbesondere im Umgang im Bereich Barrierefreiheit, Mensch-Maschine-Interaktion und digitaler Teilhabe“. Hier entwickelte Lösungen sind häufig auch auf den Nicht-Para-Sport übertragbar – etwa bei der Verbesserung von Trainingsumgebungen, dem Einsatz immersiver Technologien oder bei der Etablierung digitaler Schnittstellen zwischen Athletinnen/Athleten und Coach und können darüber hinaus auch in Medizin, Mobilität und Inklusion Anwendung finden.
Fortschritt trifft auf Barrieren
Trotz großer Innovationspotenziale attestieren die befragten Expertinnen und Experten dem Spitzensport teils massive strukturelle Defizite. Es fehlen standardisierte Datenstrategien und klare Zuständigkeiten. Besonders relevant: eine mangelnde Koordination zwischen Para- und Nicht-Para-Strukturen, obwohl gerade hier Synergien möglich wären. Beispiel KI-Scouting: Zwar gilt der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Nachwuchsbereich als technologisch machbar – aber ethische Fragen, fehlende Datenqualität und Unsicherheiten in der Anwendung bremsen eine breite Umsetzung. Ähnlich sieht es bei immersiven Trainingsumgebungen oder dem Einsatz von digitalen Avataren aus. Die technische Machbarkeit steht oft außer Frage, doch Finanzierungsmodelle, Know-how und organisatorische Offenheit bleiben die großen Hürden.
Die Studie zeigt auch: In vielen Szenarien wird dem Para Sport eine geringere Eintrittswahrscheinlichkeit bei der Nutzung neuer Technologien zugeschrieben – nicht, weil das Potenzial fehlt, sondern weil strukturelle Ressourcen und Sichtbarkeit geringer sind. Das ist ein Innovationshemmnis, das nicht sein muss – im Gegenteil: Pilotprojekte im Para Sport könnten gezielt gefördert werden, um Prototypen zu entwickeln und deren Übertragbarkeit auf andere Bereiche zu testen.
Was jetzt passieren muss
Der Spitzensport in Deutschland steht an einem Wendepunkt. Technologie kann ein zentraler Hebel für mehr Wettbewerbsfähigkeit sein – sowohl auf individueller als auch auf struktureller Ebene. Doch dafür braucht es gezielte Investitionen und besonders eine engere Kooperation zwischen Para- und Nicht-Para-Verbänden. Gerade im Para Sport liegt ein weitgehend ungenutztes Potenzial: Durch seine technologischen Anforderungen und seine gesellschaftliche Relevanz kann er zum Treiber einer inklusiven Sportinnovation werden. Was heute im Para Sport getestet wird, könnte morgen Standard im Spitzensport und übermorgen Teil unseres Alltags sein – von smarter Mobilität bis zur robotischen Assistenz im Gesundheitswesen. Ein zukunftsfähiger Spitzensport muss also mehr sein als leistungsorientiert. Er muss technologisch anschlussfähig, ethisch reflektiert und strukturell flexibel sein. Und: Er sollte den Mut haben, Innovation dort zuzulassen, wo sie heute schon notwendig ist – im Para Sport.
Weiterführende Informationen:
Die vollständige Delphi-Studie „Innovation und Inklusion – Technologien im Spitzensport im Jahr 2040“ findest du hier. Diese Studie wurde durch das Bundesinstitut für Sportwissenschaft gefördert.
Den Beitrag der WHU – Otto Beisheim School of Management, der diesen Insight inspiriert hat, findest du hier.




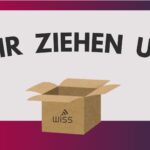


Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Kommentare zu hinterlassen.